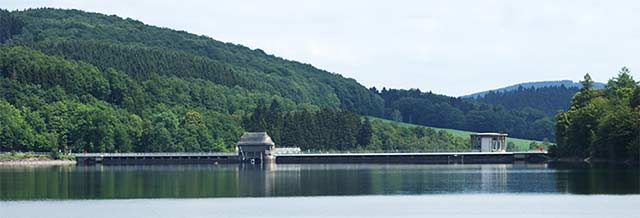Herford – ehemals freie Reichs- und Hansestadt
Die im Jahr 789 gegründete Stadt Herford liegt im Ravensberger Hügelland zwischen Teutoburger Wald und Wiehengebirge an bereits zu damaliger Zeit wichtigen Handels- und Heerstraßen und deren Furten über die Flüsse Aa und Werre. Das um 800 gegründete Frauenstift Herford wurde bald nach seiner Gründung in den Stand einer Reichsabtei erhoben und erlangte im 12. Jahrhundert die Reichsunmittelbarkeit, die das Stift bis 1803 bewahren konnte. In Nachbarschaft zur Abtei entwickelte sich die Stadt Herford im frühen Mittelalter zu einer der bedeutendsten und am stärksten befestigten Handelsstädte Westfalens. Ab 1342 gehörte Herford der Hanse an. Seit Mitte des 13. Jahrhunderts bis um 1530 nahm eine kondominiale Regierung von Stift und Stadt reichsstädtisches Recht wahr. Spätestens 1631 erlangte neben der Abtei auch die Stadt Herford selbst die Reichsfreiheit, die zuvor umstritten war. Bereits 1647/1652 verlor die Reichsstadt Herford ihre Reichsfreiheit durch Annexion durch das Kurfürstentum Brandenburg.
Bis zur Reformation war Herford auch ein bedeutender Sammelpunkt der Jakobspilger auf dem Weg nach Santiago de Compostela. Die Stadt lag verkehrsgünstig am Kreuzungspunkt der Handelsstraßen von Mainz nach Lübeck und von Hameln nach Osnabrück. Im Norden verlief der Hellweg vor dem Santforde (die heutige Bundesstraße 65), im Süden der Hellweg von Paderborn nach Soest. Zahlreiche in Herford ansässige Bruderschaften kümmerten sich um die durchreisenden Pilger und unterhielten Hospitäler und Herbergen.
Anziehungspunkte für die Pilger waren die wundertätige Marienkirche als Ort der Herforder Vision sowie die heilige Pusinna, deren Reliquie in der Münsterkirche aufbewahrt wurde. In der Radewig, dem Rast- und Marktplatz der Fernhändler, wurde eine Kapelle errichtet, aus der die spätere Jakobikirche (Radewiger Kirche) entstand. Aus einer Bulle des Papstes Julius II. von 1510 geht hervor, dass die Jakobikirche keine Pfarrkirche war, sondern eine reine Pilgerkirche, die dem Jakobskult diente. Im Jahr 1530 wurde die Kirche auf Anordnung des Rates wegen der zur „Landplage“ gewordenen Pilger geschlossen. Jakobspilger wurden jedoch noch bis ins 17. Jahrhundert in der Stadt gesehen.
Das Herforder Münster
 Bis zum Ende des 15. Jahrhunderts entstanden in „Sancta Herfordia“ (dem Heiligen Herford) ca. 37 Kirchen, Kapellen, Stifte, Klöster, Hospitäler und kirchliche Häuser. Damit war das geistliche Leben dort eher mit Köln als mit anderen Städten dieser Zeit zu vergleichen. Die evangelische Münsterkirche mit der benachbarten Wolderuskapelle war die Kirche des reichsunmittelbaren Frauenstifts Herford. Die spätromanische Hallenkirche wurde vermutlich 1220–1250 erbaut und ist der erste Großbau einer Hallenkirche in Deutschland und heute die größte Hallenkirche in Westfalen. 1270–1280 entstand als letzter Teil die Zweiturmfassade, von der allerdings nur der Südturm mit einer Höhe von 66 Metern fertig geworden ist. Die Kirche wurde ursprünglich als Marienkirche erbaut. Nachdem bereits im Jahre 860 die Reliquien der heiligen Pusinna aus Frankreich nach Herford überführt worden waren und als wundertätig verehrt wurden, stand die Kirche unter einem Doppel-Patronat und trug den Namen St. Marien und Pusinna. Später wechselte der Schwerpunkt der Marien-Verehrung allmählich zur Stiftberger Marienkirche.
Bis zum Ende des 15. Jahrhunderts entstanden in „Sancta Herfordia“ (dem Heiligen Herford) ca. 37 Kirchen, Kapellen, Stifte, Klöster, Hospitäler und kirchliche Häuser. Damit war das geistliche Leben dort eher mit Köln als mit anderen Städten dieser Zeit zu vergleichen. Die evangelische Münsterkirche mit der benachbarten Wolderuskapelle war die Kirche des reichsunmittelbaren Frauenstifts Herford. Die spätromanische Hallenkirche wurde vermutlich 1220–1250 erbaut und ist der erste Großbau einer Hallenkirche in Deutschland und heute die größte Hallenkirche in Westfalen. 1270–1280 entstand als letzter Teil die Zweiturmfassade, von der allerdings nur der Südturm mit einer Höhe von 66 Metern fertig geworden ist. Die Kirche wurde ursprünglich als Marienkirche erbaut. Nachdem bereits im Jahre 860 die Reliquien der heiligen Pusinna aus Frankreich nach Herford überführt worden waren und als wundertätig verehrt wurden, stand die Kirche unter einem Doppel-Patronat und trug den Namen St. Marien und Pusinna. Später wechselte der Schwerpunkt der Marien-Verehrung allmählich zur Stiftberger Marienkirche.