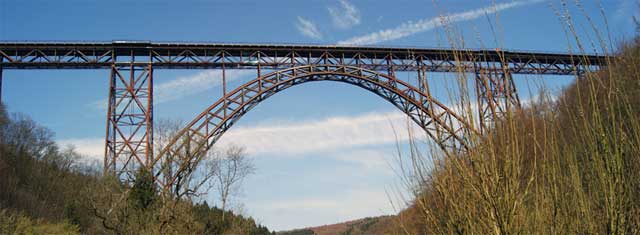Die Wildenburg
Die Wildenburg war von 1239 bis 1418 Verwaltungssitz der Freien Reichsherrschaft Wildenburg und diente vorrangig der Sicherung der Brüderstraße, einem bedeutenden mittelalterlichen Handelsweg, der die Städte Köln und Siegen verband. Durch die exponierte Lage der Burg konnten Bewegungen auf der Brüderstraße gut beobachtet werden. Mit Hermann von Wildenburg starb anno 1418 der letzte männliche Nachfahre des Geschlechtes und die Wildenburg ging als Erbe an die Familie von Hatzfeldt über.
Die St.-Anna-Kapelle
 Oberhalb von Friesenhagen auf dem Blumenberg Am Lindchen steht die St.-Anna-Kapelle, die auch „Rote Kapelle“ genannt wird. Sie wird von einer mächtigen 400-jährigen Linde überragt. Hier war die Hinrichtungsstätte während der Wildenburger Hexenprozesse in den Jahren zwischen 1613 und 1652, bei denen weit mehr als 100 Menschen als Hexen und Zauberer bei lebendigem Leibe verbrannt oder durch das Schwert hingerichtet worden sind. Nach volkstümlicher Deutung soll die „Rote Kapelle“ zur Erinnerung an diese blutigen Ereignisse zu Ehren der Hl. Anna im 17. Jahrhundert erbaut worden sein. Die Kapelle ist über den Wirtschaftsweg zwischen Ziegenschlade und Wiesental zu erreichen (GPS 007°48.6097 Ost, 50°54.5374 Nord).
Oberhalb von Friesenhagen auf dem Blumenberg Am Lindchen steht die St.-Anna-Kapelle, die auch „Rote Kapelle“ genannt wird. Sie wird von einer mächtigen 400-jährigen Linde überragt. Hier war die Hinrichtungsstätte während der Wildenburger Hexenprozesse in den Jahren zwischen 1613 und 1652, bei denen weit mehr als 100 Menschen als Hexen und Zauberer bei lebendigem Leibe verbrannt oder durch das Schwert hingerichtet worden sind. Nach volkstümlicher Deutung soll die „Rote Kapelle“ zur Erinnerung an diese blutigen Ereignisse zu Ehren der Hl. Anna im 17. Jahrhundert erbaut worden sein. Die Kapelle ist über den Wirtschaftsweg zwischen Ziegenschlade und Wiesental zu erreichen (GPS 007°48.6097 Ost, 50°54.5374 Nord).